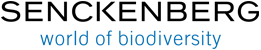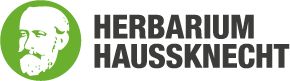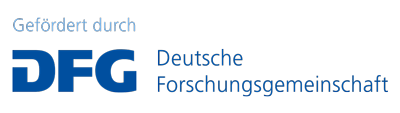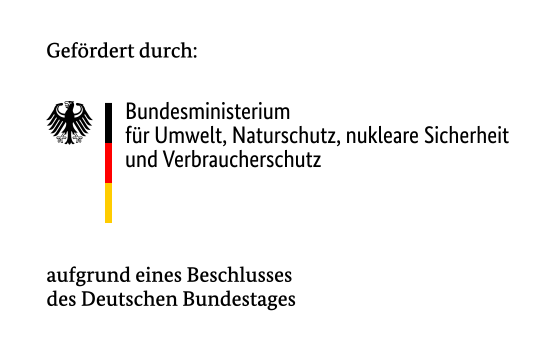Characeae C. Richard – Armleuchteralgen
Nach neueren Untersuchungen sind die Armleuchteralgen näher mit den Moosen und Gefäßpflanzen verwandt als mit den meisten Algengruppen (z.B. McCourt et al. 2004, Qui 2008). Sie sind zwar in vielerlei Hinsicht einzigartig, es wird aber im Wesentlichen eine an die Moose angelehnte Nomenklatur der Pflanzenteile verwendet; so wird die Hauptachse des Thallus in Analogie zu Gefäßpflanzen als Spross bezeichnet. Nicht zuletzt auch wegen der ökologischen Ähnlichkeit zu Gefäßpflanzen wurden die Armleuchteralgen auch in die aktuelle Bearbeitung des Rothmaler aufgenommen (Korsch in: Müller et al. 2021).
Weltweit gliedert sich die Familie in 7 Gattungen mit ca. 450 Arten. In Deutschland kommen nach gegenwärtiger Auffassung alle 7 Gattungen und 38 Arten vor.
Die Aufspaltung der Gattung Baumleuchterlage Tolypella in Sphaerochara und Tolypella erfolgte erst 2023 (Schubert et al. 2024). Außerdem wurde bei der Bearbeitung der Characeen auf europäischer Ebene (Schubert et al. 2024) Chara curta auf Artebene aufgenommen. In Deutschland (Korsch et al. 2013; Arbeitsgruppe Characeen Deutschlands 2016) war diese Sippe bislang als zu Ch. aspera gehörig betrachtet worden. Ähnlich verhält es sich mit Ch. dissoluta, die in Deutschland bislang als unsichere Art geführt wurde. Diese Neufassungen konnten bei der Bearbeitung für den Rothmaler noch nicht berücksichtigt werden.
Viele Vertreter der Characeae sind an eher klare und nährstoffarme Gewässer gebunden. Die einzelnen Sippen weisen oft eine deutliche Präferenz bezüglich des Karbonatgehaltes des Wassers auf. Die Mehrzahl der Chara-Arten bevorzugt karbonatreiche Gewässer. Bei den meisten Nitella-Arten ist es umgekehrt. Typisch ist ihr oftmals unregelmäßiges Auftreten. So kann man in einem Jahr einen großen Bestand an Armleuchteralgen vorfinden, um sie im nächsten Jahr im selben Gewässer vergeblich zu suchen. Wenn sie jedoch ein Gewässer erst einmal besiedelt haben, findet man oft zahlreiche Vermehrungseinheiten (Oosporen) im Sediment. Diese bleiben lange Zeit, z.T. jahrzehntelang keimfähig (Stobbe et al. 2014) und können bei veränderten Umweltbedingungen oder nach einer Sanierung des Gewässers erstaunlich schnell wieder zu großen Beständen führen. Umgekehrt erliegen viele Arten der Characeae im Zuge der Sukzession vor allem in kleineren Gewässern sehr schnell dem Konkurrenzdruck anderer Makrophyten. Eine Reihe von Armleuchteralgen weist eine mehr oder weniger deutliche jahreszeitliche Bindung auf. Es lassen sich Frühjahrs- und Sommer/Herbst-Arten unterscheiden. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Wassertemperatur.
Ihren Vorkommensschwerpunkt haben die Characeen in Standgewässern, aber auch langsam fließende Gräben werden bei entsprechender Wasserqualität oft besiedelt. Schneller fließende Bäche oder gar Flüsse dienen eher selten als Habitate und nur ausnahmsweise können einige Arten auch an dauernd sickerfeuchten Stellen wachsen.
Neben den natürlichen Seen vor allem in Norddeutschland und im Alpenvorland, den Boddengewässern an der Ostsee und den Gewässern der größeren Flussauen haben durch den Menschen geschaffene Sekundärgewässer eine sehr große Bedeutung als Lebensraum für Armleuchteralgen. Hier sind zunächst die wassergefüllten Restlöcher des Braunkohle-, Kies-, Sand- und Tonabbaus zu nennen. In weiten Gebieten sind dies heute die wichtigsten Characeen-Gewässer. Alte Fischteiche, wie sie vor allem in Teilen Bayerns, in Sachsen und im südlichen Brandenburg charakteristisch sind, verdienen insbesondere bei extensiver Bewirtschaftung eine besondere Beachtung. Auch die vielen Kleingewässer der Kulturlandschaft sind bedeutsam für Armleuchteralgen. Einige Arten sind in ihrem Vorkommen sogar auf solche Gewässer beschränkt oder haben dort ihren Verbreitungsschwerpunkt. Besonders hervorzuheben sind hier aufgrund der Vielfalt und der Seltenheit der vorkommenden Arten die in der Vergangenheit wenig beachteten temporären Kleingewässer auf Äckern vor allem in Teilen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns.
Bei den Armleuchteralgen handelt es sich um makroskopisch erkennbare grüne Pflanzen. Ihr Vegetationskörper ist für Algen stark differenziert und besteht aus einer mit wurzelähnlichen Gebilden verankerten Achse mit Knoten und von dort abgehenden quirlig gestellten Ästen und an diesen sitzenden „Blättchen“. Charakteristisch sind die oft auffällig gefärbten Fortpflanzungsorgane. Der Name Armleuchteralge leitet sich von der an einen Mehrfach-Kerzenständer erinnernden Form der Astquirle ab.
Die Armleuchteralgen unterscheiden sich durch eine Reihe von besonderen Merkmalen von allen anderen Vertretern des Pflanzenreiches. Ihre systematische Stellung ist deshalb recht isoliert und war lange Zeit umstritten. Neuerdings werden sie als näher mit den Moosen und Höheren Pflanzen als mit vielen anderen Algengruppen verwandt betrachtet. Die Besonderheiten bedingen aber auch, dass die Characeen als Gruppe relativ gut kenntlich sind. Einzelheiten ihres Baues sollen im Folgenden kurz beschrieben werden.
Ausgesprochen markant sind die Fortpflanzungsorgane der Armleuchteralgen. Sie weisen eine erhebliche Differenzierung auf und es gibt bei keiner anderen Pflanzengruppe etwas Vergleichbares. Die Antheridien setzen sich aus nahezu kugelförmig angeordneten, auffällig gemusterten Schildzellen zusammen, welche die länglichen Spermatozoiden einschließen. Kurz nach ihrer Bildung sind sie bei vielen Arten grünlich, im Laufe der Reifung werden sie dann oft orange bis bräunlich. Die Oogonien sind meist eiförmig. Charakteristisch ist die spiralige Anordnung der Schraubenzellen um die eigentliche Eizelle. Auf dieser entsteht dadurch eine typische Oberflächenstruktur. Die Zahl der Windungen und ihr Aussehen sind dabei artspezifisch. An der Spitze des Oogoniums sitzt das sogenannte Krönchen. Die Zahl seiner Zellen beträgt bei einigen Gattungen (z.B. Chara) 5 bei anderen (z.B. Nitella) dagegen 10. Bei den Characeen gibt es sowohl einhäusige (männliche und weibliche Fortpflanzungsorgane sitzen auf einem Individuum) als auch zweihäusige Arten (männliche und weibliche Fortpflanzungsorgane sitzen auf getrennten Individuen). Im Laufe der Zeit entwickeln sich die anfangs grünlichen Oogonien zu dauerhaften Oosporen. Bei vielen Chara-Arten lagern die Schraubenzellen während der Reifung Calcitkristalle ein. Die hellen, verkalkten Reste dieser Zellen bilden eine je nach Art unterschiedlich stabile Hülle um die eigentliche Oospore. Solche von einer Hülle umgebenen Oosporen werden als Gyrogonite bezeichnet. Die Oosporen selbst sind artspezifisch unterschiedlich von hellbraun bis schwarz gefärbt. Sie können im Sediment lange überdauern und ähnlich wie Pollen noch nach Jahrtausenden Aufschluss über die einstige Besiedlung von Gewässern geben. Die Keimung erfolgt in der Regel nur bei ausreichendem Lichtgenuss. Durch die lange Überdauerungsfähigkeit der Oosporen können die Characeen in einmal besiedelten Gewässern auch noch nach Jahrzehnten des Ausbleibens bei verbesserten Bedingungen innerhalb kürzester Zeit wieder große Bestände aufbauen. Bei einigen Nitella-Arten wird jeweils ein ganzes fertiles Köpfchen von einer Schleimhülle umschlossen. Diese ist bei den Männchen meist ausgeprägter entwickelt als bei den Weibchen.
Ein Charakteristikum der Armleuchteralgen ist ihre Fähigkeit, sich mit Phosphor-Verbindungen aus dem Sediment zu versorgen. Dies verschafft ihnen in Gewässern mit wenig gelöstem Phosphat einen erheblichen Konkurrenzvorteil gegenüber den meisten anderen Algen. Ermöglicht wird dies durch die Rhizoiden, die ähnlich wie die Wurzeln bei Höheren Pflanzen neben der Verankerung auch die Aufnahme von Nährstoffen aus dem Boden gewährleisten. Als Sonderbildung bringen einige Arten an den Rhizoiden Bulbillen hervor, die zur Überwinterung und vegetativen Vermehrung dienen. Zu beobachten ist dieses Phänomen vor allem bei der Rauen Armleuchteralge (Chara aspera) und der Stern-Glanzleuchteralge (Nitellopsis obtusa). Oberhalb der Rhizoiden setzt der Spross an. Typisch ist für alle Characeen der regelmäßige Wechsel zwischen kurzen Knoten- und langen Zwischenknotenzellen. Dies führt zu dem allen Armleuchteralgen gemeinsamen Habitus. Nur die Knotenzellen teilen sich auch weiterhin und bringen die anderen Organe hervor. Bei allen heimischen Arten entwickeln sich einfache oder gabelig geteilte Äste, an denen die oben beschriebenen Fortpflanzungsorgane ansitzen. Viele Vertreter der Gattung Chara haben außerdem Stipularen und in den meisten Fällen auch Rindenzellen. Letztere umschließen die Sprossachse und in unterschiedlichem Maße auch die Äste. An den Ästen sitzen bei den Chara-Arten neben den Antheridien und Oogonien auch noch die Blättchen. Sowohl die Lebensdauer als auch die Phänologie der Characeen werden maßgeblich vom Standort beeinflusst. Viele Arten sind potentiell ausdauernd. Diese Fähigkeit können sie aber nur bei Vorkommen im tieferen Wasser entfalten. Gerade einige der größeren Arten (z.B. die Steifborstige Armleuchteralge – Ch. hispida und die Hornblättrige Armleuchteralge – Ch. tomentosa) neigen zur Bildung großflächiger Einart-Bestände. Diese überdauern den Winter und bilden so schon im Frühjahr eine wirksame Barriere gegen das Eindringen anderer Arten, auch solcher der Höheren Pflanzen. Möglich ist dies aber nur, wenn die Pflanzen in einer Tiefe siedeln, die nicht von der Eisbildung betroffen ist. Nicht nur Eis im Winter sondern auch zu hohe Wassertemperaturen im Sommer können im Flachwasser wachsende Characeen zum Absterben bringen. An solchen Stellen muss dann jeweils eine Neuentwicklung der Pflanzen aus Oosporen oder einzelnen noch lebenden, teilungsfähigen Knotenzellen erfolgen.
Die Baumleuchteralgen (Tolypella-Arten) sind wohl in aller Regel kurzlebig. Die Kleine Baumleuchteralge (T. glomerata) keimt meist im zeitigen Frühjahr und stirbt oft schon im Mai oder Juni wieder ab. Obwohl viele Armleuchteralgen ausdauernd sind, kann man trotzdem mehr oder weniger ausgeprägte fertile Phasen beobachten. Bei einer Reihe von verbreiteten Chara-Arten (z.B. Gewöhnliche Armleuchteralge – Chara vulgaris; Steifborstige A. – Ch. hispida) dauert die vegetative Entwicklung das Frühjahr über an; meist erst ab Mai oder Juni und von da an bis in den Herbst werden Antheridien und Oogonien entwickelt. Andere haben einen deutlichen Fertilitäts-Schwerpunkt im Frühjahr (z.B. Hornblättrige Armleuchteralge – Chara tomentosa; Dunkle Glanzleuchteralge – Nitella opaca; Feine G. – N. capillaris; Kleine Baumleuchteralge – Tolypella glomerata). Bei all diesen Arten ist zu beobachten, dass sich die fertile Phase umso mehr nach hinten verschiebt, je tiefer im Wasser die Individuen siedeln. Außerdem kann manchmal im Herbst noch eine zweite, weniger ausgeprägte fertile Periode beobachtet werden. Typische Sommerarten sind bei den Characeen deutlich seltener. Zu nennen ist die Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge (Nitella syncarpa), die sich in aller Regel erst ab August bis in den Oktober hinein entwickelt. Beeinflusst wird die Entwicklung auch vom Vorhandensein oder Fehlen von Wasser. In temporären Gewässern, aber auch in nach einer Trockenphase wieder aufgefüllten Teichen können Arten zu für sie eigentlich untypischen Jahreszeiten wachsen und fruchten.
Finden
Armleuchteralgen besiedeln viele verschiedene Gewässertypen. Genaueres dazu wurde unter „Vorkommen“ dargelegt, hier sollen eher allgemeine Hinweise gegeben werden. Die Characeen kann man als „Schönwetter-Pflanzen“ bezeichnen. Subjektiv kostet es bei sonnigem und warmem Wetter weniger Überwindung, ins Wasser zu fassen oder gar hinein zu gehen und die nassen Pflanzen in die Hand zu nehmen. Es gibt aber auch objektive Gründe vor allem bei ausreichenden Lichtverhältnissen nach Armleuchteralgen zu suchen. Bei Sonnenschein kann man viel tiefer in Gewässer hineinsehen, als bei bewölktem Himmel. Dies macht sich schon vom Ufer aus deutlich bemerkbar. Beim Schnorcheln hat man bereits beim Aufziehen nur dünner Schleierwolken den Eindruck, jemand hätte das Licht ausgeschaltet. Hilfreich beim Absuchen von Gewässern sind Sonnenbrillen mit Polarisationsfilter. Diese mildern die fast immer vorhandenen Reflexionen an der Wasseroberfläche erheblich. Große Arten wie die Steifborstige Armleuchteralge (Chara hispida) sind leicht zu entdecken, kleine Glanzleuchteralgen nimmt man meist erst mit einer gewissen Erfahrung war. Zu beachten ist, dass oft mehrere Arten in einem Gewässer zusammen vorkommen. Im flachen Wasser erreichen die Characeen gelegentlich die Oberfläche und ragen dann sogar etwas aus dem Wasser. Häufiger wachsen sie allerdings am Gewässergrund und müssen dort gezielt gesucht werden. Anders als bei „normalen“ Wasserpflanzen sinken abgerissene Sprossstücke der Armleuchteralgen schnell zum Gewässergrund und werden deshalb nicht ans Ufer angespült. Sind am Ufer und in dessen unmittelbarer Nähe keine Characeen zu sehen, bedeutet dies also nicht unbedingt, dass im Gewässer keine vorkommen.
Zu beachten sind weiterhin jahreszeitliche und längerfristige Schwankungen des Auftretens der Armleuchteralgen. Als erstes sind die zeitlichen Unterschiede der Entwicklung bei einzelnen Arten zu nennen. So wurde in einem Graben bei Jeseritz in der Altmark bei einer Untersuchung im Mai massenhaft die Haarfeine Glanzleuchteralge (Nitella capillaris) sowie jeweils vereinzelt die Zerbrechliche Armleuchteralge (Chara globularis) und die Feine A. (Ch. virgata) gefunden. Bei einem zweiten Besuch im September war dann die Gewöhnliche A. (Ch. vulgaris) neben der Zerbrechlichen Armleuchteralge die häufigste Art. Von der Haarfeinen Glanzleuchteralge konnten nur wenige, erst vor kurzem aufgewachsene Exemplare beobachtet werden, die Feine Armleuchteralge fehlte völlig.
Auch einige generelle Phänomene sind von Bedeutung. Viele Gewässer unterliegen im Laufe des Jahres starken Veränderungen der Sichttiefe. Meist ist im Frühjahr das Wasser klarer als im phytoplanktonreicheren Sommer, zum Herbst hin kann dann oft wieder eine Abnahme des Planktons und damit eine Verbesserung der Sichttiefe festgestellt werden. Auch fädige Grünalgen entwickeln sich vor allem während des Sommers sehr schnell und überwuchern eventuell vorhandene Characeen. Diese sind dann nur im Frühjahr sichtbar.
Erheblichen Einfluss auf die Beobachtungsmöglichkeiten von Characeen haben Starkniederschläge. Diese führen gerade bei an Bäche angeschlossenen Teichen oft zu einer massiven Trübung des Wassers. Im Umfeld größerer Flüsse wie z.B. der Elbe hat ein gestiegener Wasserspiegel zur Folge, dass die dauerhaft wassergefüllten Senken gar nicht mehr erreicht werden können. Auch Witterungsereignisse haben deutlichen Einfluss auf die Entwicklung der Characeen. Im Jahr 2013 wurden einige bereits früher untersuchte Gewässer noch einmal angesehen. Dabei zeigte sich, dass in vielen die Characeen in diesem Jahr schlechter entwickelt waren als bei den vorherigen Untersuchungen. Vor allem die Steifborstige Armleuchterlage (Chara hispida) war oft in deutlich geringerer Menge vorhanden. Aber auch bei anderen Arten wurden ähnliche Beobachtungen gemacht. Dagegen waren die Brackwasser A. (Ch. canescens) bei Angersdorf, die Vielstachelige A. (Ch. aculeolata) bei Lunstädt und die Kleine Baumleuchteralge (Tolypella glomerata) bei Burgliebenau in diesem Jahr sehr üppig entwickelt. Zu den Ursachen können nur Vermutungen angestellt werden. Wahrscheinlich hat der kalte, mit einer langen Eisbedeckung einhergehende Winter für veränderte Konkurrenzbedingungen zu Beginn der Wuchsperiode gesorgt, mit denen die verschiedenen Arten (ob Characeen, Gefäßpflanzen oder Grünalgen) sehr unterschiedlich gut zurechtgekommen sind.
Als Fazit lässt sich festhalten: es gibt keine optimale Jahreszeit zum Kartieren von Armleuchteralgen sondern bestenfalls für konkrete Arten. Ein einmaliges Aufsuchen eines Gewässers reicht oft nicht aus, um den Artenbestand vollständig zu erfassen. Auch Gewässer, in denen zum Untersuchungszeitpunkt keine Characeen gefunden wurden, können durchaus in späteren Jahren von diesen besiedelt sein, ohne dass ein erneuter Eintrag von Diasporen stattgefunden haben muss.
Sammeln
Zur Entnahme von Proben vom Ufer aus können Wasserpflanzen-Anker verwendet werden, typischerweise aus dem Eigenbau. Die einfachste und billigste Variante besteht aus einem kleinen Eisenrechen mit eng stehenden Zinken ohne Stiel, der an einem stabilen Seil befestigt wird. Günstig ist es, entweder die Hälfte der Zinken nach hinten zu biegen oder zwei Rechen zu kombinieren, damit unabhängig von der Orientierung auf jeden Fall Pflanzen am Rechen hängenbleiben. Der Rechen wird dann ins Gewässer hineingeworfen und am Seil zurückgeholt. So können durchaus Proben bis zu einer Entfernung von 20 m vom Ufer gewonnen werden. Bei größeren Gewässern muss man zur Pflanzenentnahme ins Wasser, entweder mit Stiefeln, mit einer Wathose oder schwimmend. In den meisten Fällen reicht Schnorcheln aus, um die Armleuchteralgen vollständig zu erfassen. In der fast durchgehend eutrophierten Landschaft gibt es leider nur wenige Gewässer die sauber genug sind, dass Characeen so tief im Wasser wachsen, dass sie auf diese Weise nicht erreicht werden können. Grundsätzlich sollte man lieber etwas umfangreicheres Material mitnehmen als zu wenig. Manchmal sind bestimmte, für die Bestimmung wichtige Merkmale nicht an allen Pflanzenteilen gut entwickelt. Eine größere Probenmenge erhöht dann die Chance, die im Schlüssel abgefragten Merkmale doch irgendwo richtig erkennen zu können. Da die Armleuchteralgen an vielen Vorkommen durch vegetative Vermehrung große Bestände aufbauen, ist dies aus Naturschutzsicht meist unproblematisch. Trotzdem sollte darauf geachtet werden, die Populationen durch die Entnahme der Pflanzen möglichst wenig zu schädigen.
Die so erhaltenen Pflanzen werden zum Transport in Plastikgefäße gegeben. Diese sollten nicht zu klein sein, damit die Algen beim Einbringen nicht stark geknickt werden müssen. Zwar sind Folientüten durchaus ausreichend, formstabile Plasteschachteln haben aber den Vorteil, dass die Proben darin weniger beschädigt werden. Wichtig ist, dass die Pflanzen gut vor dem Austrocknen geschützt werden. Sind die Armleuchteralgen der Umgebungsluft ausgesetzt, beginnen sie innerhalb weniger Minuten zu vertrocknen und werden in kürzester Zeit brüchig.
Bestimmen
Zur Bestimmung der Characeen ist vor allem in der Einarbeitungsphase ein Auflichtmikroskop unverzichtbar. Mit einiger Erfahrung kann man zwar schon im Gelände viele Pflanzen benennen, aber selbst geübte Kenner müssen immer wieder auf die Hilfe einer ausreichenden Vergrößerung zurückgreifen. Die Armleuchteralgen entwickeln sich in der Regel bei voller Besonnung am besten. Pflanzen, die in beschatteten, trüben oder sehr tiefen Gewässern stehen, weisen oft einige Abweichungen auf. Meist wird dann die Bestachelung, in wenigen Fällen sogar die Berindung reduziert. Außerdem verlängern sich die Internodien, was zu einem etwas anderen Habitus führt.
Armleuchter-(Chara-)Arten lassen sich in der Regel auch steril anhand von Berindungs- und Stachelmerkmalen bestimmen. Die Merkmale sind nahe der Sprossspitze oft am besten zu erkennen. Dabei ist es günstig, nicht das erste sondern besser das zweite Internodium anzusehen. Hier haben sich die Zellen bereits so weit gestreckt, dass die Bestachelung nicht mehr ganz so dicht steht. Außerdem sind hier die Unterschiede zwischen den erhabenen und den eingesenkten Rindenzellen schon deutlicher ausgeprägt. Den Inserierungstyp der Stacheln ermittelt man am besten nahe der Sprossknoten. Mit ein wenig Übung braucht man dazu keine Querschnitte anzufertigen. Je weiter man sich von der Sprossspitze entfernt, desto weniger Stacheln sind noch vorhanden. Manchmal lösen sich sogar die Rindenzellen ab und nur der Zentralstrang bleibt übrig. Solche Fragmente lassen sich nicht mehr bestimmen.
Schwieriger gestaltet sich die Bestimmung der Glanzleuchter-(Nitella-)Arten. Durch das Fehlen von Rinde und Stacheln stehen deutlich weniger Merkmale zur Verfügung. Deshalb lassen sich einige Arten nur fertil sicher erkennen. Hier hilft es manchmal, größere Probenmengen durchzusehen. Mit etwas Glück findet sich oft auch bei scheinbar sterilen Pflanzen dann doch der eine oder andere fertile Spross. Einige Glanzleuchter-(Nitella-)Arten schließen ihre Gametangien in eine Schleimhülle ein. Bei anderen täuscht ein, auch bei der Herausnahme aus dem Wasser in den köpfchenartig verdichteten Sprossspitzen verbleibender, Wassertropfen eine solche nur vor. Mit Hilfe eines Papiertaschentuches kann man aber sehr leicht Klarheit erhalten. Wird der Tropfen vom Taschentuch aufgesaugt, war es nur Wasser, denn richtige Schleimhüllen bleiben auch beim Abtupfen erhalten.
Herbarisieren
Prinzipiell erfolgt das Herbarisieren von Armleuchteralgen ähnlich wie bei Höheren Pflanzen. In Plastiktüten oder –schachteln (ohne Wasser!), lassen sie sich mehrere Stunden, im Kühlschrank sogar Tage aufbewahren, ohne Schaden zu nehmen. Sehr wichtig ist eine aussagekräftige Etikettierung mit Angaben zum Fundort, Sammeldatum und Sammler. Besonderheiten sind der oft zierliche Wuchs und bei den Armleuchter-(Chara-)Arten die Zerbrechlichkeit im trockenen Zustand. Am besten ist es, wenn man die Pflanzen in noch feuchtem Zustand auf einen A4-Bogen Papier oder Karton (ca. 160–200 g/m², normales Kopierpapier hat 80 g/m²) aufbringt. Dieser wird dann zum Trocknen zwischen saugfähiges Papier gelegt und mit schweren Objekten (z.B. Bücher) oder Bändern gepresst. Damit die Pflanzen nur am Auflagebogen und nicht am Trockenpapier haften, hat es sich bewährt, sie während des Trocknens mit einem Blatt handelsüblichen Backpapiers zu bedecken. Dieses kann mehrfach verwendet werden. In der Regel reicht es, die Papierlagen zwischen den Bögen mit den Pflanzen zweimal zu wechseln. Da Characeen keinerlei Verdunstungsschutz besitzen, sind die Pflanzen deshalb meist bereits nach einem Tag völlig trocken. Erst einmal herbarisiert, müssen vor allem die Chara-Arten vorsichtiger als andere Pflanzen behandelt werden. Ein Versand in einem einfachen Brief, der bei der Post durch Sortiermaschinen läuft, führt in der Regel dazu, dass nur noch Bruchstücke ankommen. Die Bestimmung gestaltet sich dann schwierig.
Das Portal enthält alle bei Korsch in Müller et al. (2021) verschlüsselten Taxa sowie Chara curta und Ch. dissoluta. Systematik und Nomenklatur folgen der Bearbeitung der Characeae auf europäischer Ebene (Schubert et al. 2024).
Abweichend von den anderen Taxa im Portal werden bei den Characeen auch Lebendfotos der Pflanzen präsentiert. Zudem wurden Aufnahmen der bestimmungswichtigen morphologischen Details nur exemplarisch von ausgewählten Belegen angefertigt.
Für die Bereitstellung der exzellenten Lebendfotos danken wir Silke Oldorff, Volker Krautkrämer, Robert Schmidt, Lorenz Seebauer und Klaus van de Weyer. Außerdem danken wir der Datz-Stiftung für die finanzielle Unterstützung, die die Erstellung der hochauflösenden Scans und Detailfotos ermöglichte.
Arbeitsgruppe Characeen Deutschlands Hrsg.; 2016. Armleuchteralgen. − Die Characeen Deutschlands. − Berlin, Heidelberg, 618 S.
Bruinsma, J. 2025. The glossary of the book “Charophytes of Europe”. Rostocker Meeresbiologische Beiträge 34: 7-9. (Volltext) (Download Glossar)
Korsch, H. 2013. Die Armleuchteralgen (Characeae) Sachsen-Anhalts. – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 1/2013: 85 S.
Korsch, H. 2018. The worldwide range of the Charophyte species native to Germany. − Rostocker Meeresbiologische Beiträge 28: 45−96. (Volltext)
Korsch, H., Doege, A. Raabe, U. & van de Weyer, K. 2013. Rote Liste der Armleuchteralgen (Charophyceae) Deutschlands. 3. Fassung, Stand: Dezember 2012. – Haussknechtia Beiheft 17: 1–33. (Volltext)
McCourt, R. M., Delwiche, C. F. & Karol, K. G. 2004. Charophyte algae and land plant origins. – Trends Ecol. Evol. (London) 19: 661–666. (Volltext)
Müller, F., Ritz, C. M., Welk, E. & Wesche, K. (Hrsg). 2021. Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Grundband. Berlin, Heidelberg, 944 S.
Qui, Y.-L. 2008: Phylogeny and evolution of charophytic algae and land plants. – J. Syst. Evol. (Beijing) 46: 287–306. (Volltext)
Schubert, H., Blindow, I., Nat, E., Korsch, H., Gregor, T., Denys, L., Stewart, N., van de Weyer, K., Romanov, R. & Casanova, M. T. (Hrsg). 2024. Charophytes of Europe. Cham, Switzerland, 1144 S.
Stobbe, A., Gregor, T. & Röpke, A. 2014. Long-lived banks of oospores in lake sediments from the Trans-Urals (Russia) indicated by germination in over 300 years old radiocarbon dated sediments. − Aquatic Botany 119: 84−90. (Volltext)
Korsch, H. 2025. Characeae C. Richard. In: Dressler, S., Gregor, T., Hellwig, F. H., Korsch, H., Wesche, K., Wesenberg, J. & Ritz, C. M. Bestimmungskritische Taxa der deutschen Flora. Herbarium Senckenbergianum Frankfurt/Main, Görlitz & Herbarium Haussknecht Jena. [online] https://bestikri.senckenberg.de